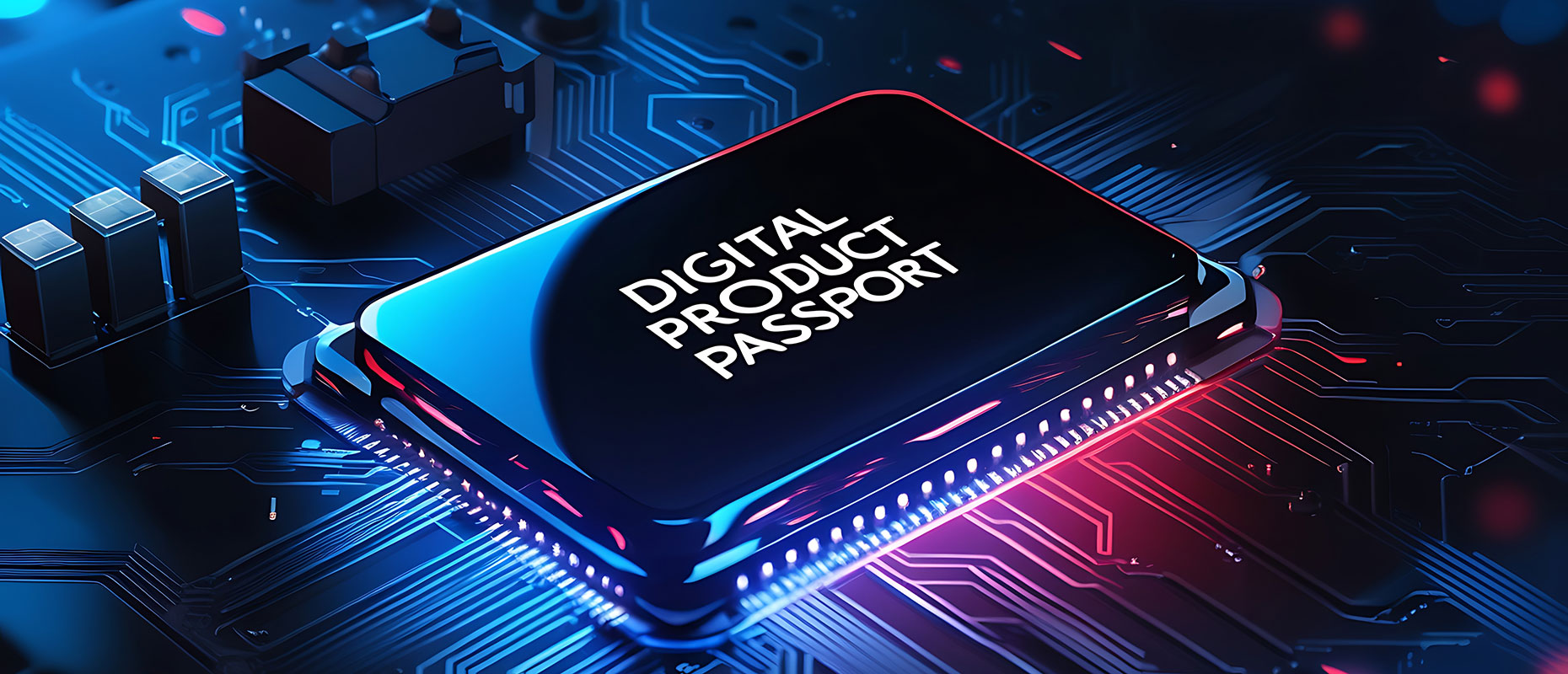
Mit dem Digitalen Produktpass (DPP) steigen die Anforderungen an vollständige, saubere und zentral verfügbare Produktinformationen. Ab 2026 wird es für erste Branchen ernst. In unserem Artikel zeigen wir, welche Chancen in der Einführung des Digitalen Produktpasses liegen und wie ein PIM helfen kann, ihn umzusetzen.
Inhaltsverzeichnis:
Digitaler Produktpass Definition
Der Digitale Produktpass ist ein zentrales Element der EU-Strategie für mehr Kreislaufwirtschaft und Transparenz. Er soll Produktdaten über den gesamten Lebenszyklus hinweg digital zugänglich machen – von Materialien und Herkunft über Reparaturhinweise bis zu Recyclinginformationen.
Digitaler Produktpass: Ab wann und für welche Branchen?
Ab 2026 beginnt die schrittweise Einführung des Digitalen Produktpasses auf Basis der EU-Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte (ESPR). Die konkrete Pflicht gilt nicht für alle Branchen gleichzeitig, sondern wird für einzelne Produktgruppen durch sogenannte delegierte Rechtsakte festgelegt. Erste verbindliche Regelungen existieren bereits, etwa für Batterien (Batterieverordnung, gültig ab 2027 für bestimmte Datenpflichten). Weitere Produktgruppen – z. B. Textilien, Elektronik, Möbel – folgen nach und nach mit jeweils spezifischen Anforderungen und Zeitplänen. Der DPP betrifft vor allem Branchen mit komplexen Produkten, hohen Nachhaltigkeitsanforderungen und regulatorischem Druck.
Warum der Digitale Produktpass nicht nur Pflicht, sondern auch eine Chance ist
Oft wird der DPP zunächst als zusätzliche gesetzliche Hürde wahrgenommen. Doch richtig umgesetzt, kann er Wettbewerbsvorteile schaffen:
- Vertrauen und Transparenz: Kunden und Geschäftspartner sehen sofort, wie nachhaltig und regelkonform Ihre Produkte sind.
- Effizienz: Eine zentrale Datenbasis spart Zeit bei Audits, Zertifizierungen und Anfragen.
- Innovation: Einheitliche Produktdaten lassen sich leichter für neue Services, wie Reparaturportale oder Second-Life-Angebote, nutzen.
- Nachhaltigkeit messbar machen: Infos zum CO₂-Fußabdruck, zur Recyclingfähigkeit und ähnlichen Themen können lückenlos dokumentiert werden.
Die Herausforderung des Digitalen Produktpasses liegen in der Datenqualität und -verfügbarkeit. An dieser Stelle kommt die Wahl der richtigen IT-Systeme ins Spiel, den der Kern des DPP ist Datenmanagement. Die größten Stolpersteine dabei sind:
- Verstreute Datenquellen – Stücklisten im ERP, technische Datenblätter in PDF-Archiven, Nachhaltigkeitsinfos in Excel.
- Uneinheitliche Formate – unterschiedliche Schreibweisen, Maßeinheiten, Klassifikationen.
- Fehlende Automatisierung – manuelle Aktualisierung kostet Zeit und ist fehleranfällig.
Wie ein PIM-System helfen kann, den DPP umzusetzen
Ein Product Information Management (PIM)-System kann im Kontext des Digitalen Produktpasses (DPP) eine zentrale Rolle spielen – vor allem bei der Bereitstellung konsistenter, vollständig gepflegter Produktdaten:
- Zentrale Datendrehscheibe: Das PIM bündelt marketing- und vertriebsrelevante Produktinformationen und kann DPP-spezifische Attribute aufnehmen, während technische Daten aus PLM oder ERP angebunden werden.
- Datenqualität sichern: Validierungsregeln, Pflichtfeldprüfungen und Freigabe-Workflows sorgen für konsistente und vollständige Datensätze gemäß den jeweils geltenden DPP-Anforderungen.
- Flexible Ausgabeformate: PIM-Systeme können die benötigten Daten in den jeweils geforderten Standard- oder Austauschformaten exportieren – wichtig, da die finalen DPP-Datenstrukturen in vielen Branchen noch konkretisiert werden.
- Systemintegration: Über APIs, direkte Schnittstellen oder Integrationsplattformen (z. B. iPaaS) kann das PIM nahtlos mit ERP, PLM, PDM oder IoT-Plattformen verbunden werden, um redundante Pflege zu vermeiden und die Datenflüsse zu automatisieren.
Wichtig: Der Unterschied zwischen PIM- und PLM-Daten im Kontext des Digitalen Produktpasses (DPP) ist zentral, weil hier oft falsche Erwartungen an ein einzelnes System entstehen.
PLM-Daten (Product Lifecycle Management)
Fokus: Produktentwicklung, Konstruktion, technische Änderungen und Lebenszyklusverwaltung.
Typische Inhalte:
- CAD-Modelle, Stücklisten (BOMs)
- Material- und Komponentenspezifikationen
- Produktionsprozesse, Test- und Prüfberichte
- Änderungs- und Freigabehistorie
DPP-Relevanz: Enthält viele der technischen Basisdaten, die für Nachhaltigkeit, Reparierbarkeit und Recycling im DPP nötig sind (z. B. Materialzusammensetzung, Herstellungsverfahren, Reparaturhinweise).
PIM-Daten (Product Information Management)
Fokus: Vermarktung und Vertrieb – zentrale Verwaltung von Produktinformationen für alle Ausgabekanäle.
Typische Inhalte:
- Produktbeschreibungen, Marketingtexte
- Bilder, Videos, Anleitungen
- Vertriebsattribute (Maße, Gewicht, Farben, Varianten)
- Übersetzungen und länderspezifische Angaben
DPP-Relevanz: Ideal für die Anreicherung (Enrichment) und Harmonisierung der vom PLM/ERP kommenden Daten, damit diese im DPP einheitlich, vollständig und mediengerecht bereitgestellt werden können.
Fazit:
PLM liefert die technisch-konstruktive Wahrheit (Engineering Data). PIM liefert die kommunikative und strukturierte Ausgabefassung für externe Stakeholder. Für den DPP sind beide nützliche Datenlieferanten – oft in Kombination mit Daten aus dem mit ERP – und unter Nutzung einer Integrationsschicht (z. B. API, iPaaS), die es ermöglicht, diese Daten automatisiert zusammenzuführen.
PIM und Digitaler Produktpass – ein Praxisbeispiel
Stellen Sie sich vor: Ein Hersteller von Haushaltsgeräten muss für jedes Modell Materialzusammensetzung, Reparaturhinweise und Energieverbrauch digital bereitstellen.
Mit einem PIM-System werden im Idealfall Daten aus ERP, PLM/CAD-Systemen und Lieferantenportalen zentral zusammengeführt, auf Vollständigkeit (z. B. fehlende Recyclinginformationen) geprüft in den jeweils geforderten Standard- oder Austauschformaten an die DPP-Plattform exportiert. So entsteht eine vollständige, standardisierte Datenbasis, die auch für Nachhaltigkeitsberichte, Zertifizierungen und interne Traceability-Prozesse genutzt werden kann.
Der Bonus: Auch für virtuelle Abbilder Ihrer Produkte (digitale Zwillinge) bildet ein PIM die ideale Datenbasis.
Fazit: Brauchen Sie für den DPP ein PIM-System?
Insbesondere bei größeren Produktportfolios und mehreren Datenquellen kann ein PIM erheblich zur Umsetzung beitragen. Es verbessert nicht nur die Datenqualität und Effizienz, sondern erleichtert auch langfristig die Einhaltung von Nachhaltigkeits- und Compliance-Vorgaben.
Wenn Sie also:
- mehr als eine Handvoll Produkte im Portfolio haben,
- Daten aus mehreren Quellen zusammenführen müssen,
- und dabei Rechtssicherheit und Effizienz im Blick behalten wollen,
… dann ist ein PIM-System eine strategische Investition – nicht nur für die Umsetzung des Digitalen Produktpasses.
Tipp: Der Zeitplan für den Digitalen Produktpass läuft – und die Erfahrung zeigt: Wer früh beginnt, hat später weniger Stress. Falls Sie prüfen möchten, ob ein PIM-System im Kontext der Umsetzung des DPP in Ihrem Unternehmen hilfreich sein könnte, empfiehlt sich eine unverbindliche Bestandsaufnahme. Da die Einführung des DPP schrittweise erfolgt und die Anforderungen je Branche variieren, ist eine frühzeitige Analyse der bestehenden Systemlandschaft ratsam. So lässt sich feststellen, ob vorhandene Systeme (ERP, PLM, PIM) ausreichen oder ob zusätzliche Lösungen nötig sind, um die geforderten Daten strukturiert und fristgerecht bereitzustellen.
Für Einsteiger
PIM = Produkt-Informationsmanagement (Schwerpunkt marketing- und vertriebsrelevante Daten)
PLM = Product Lifecycle Management (Schwerpunkt Verwaltung und Steuerung des gesamten Produktlebenszyklus von der Idee bis zum Recycling)
PDM = Product Data Management (Schwerpunkt zentrale Verwaltung und Versionierung technischer Produktdaten und CAD-Dokumente)
ERP = Enterprise Resource Planning (Schwerpunkt integrierte Planung und Steuerung von Unternehmensressourcen wie Material, Personal, Finanzen)
CAD = Computer-Aided Design (Schwerpunkt rechnergestützte Konstruktion und Modellierung von Produkten)
API = Application Programming Interface (Schwerpunkt definierte Schnittstelle zur Anbindung und Integration von Softwareanwendungen)
iPaaS = Integration Platform as a Service (Schwerpunkt cloudbasierte Plattform zur Verbindung und Orchestrierung verschiedener Anwendungen und Datenquellen)
Traceability = Rückverfolgbarkeit (Schwerpunkt lückenlose Nachverfolgung von Materialien, Komponenten und Prozessen entlang der Lieferkette)
Bildquelle: © Tech and Bussiness/AdobeStock
